Konrad Ernst Otto Zuse
Konrad Ernst Otto Zuse (* 22. Juni 1910 in Deutsch-Wilmersdorf, heute zu Berlin; † 18. Dezember 1995 in Hünfeld) war ein deutscher Bauingenieur, Erfinder und Unternehmer (Zuse KG). Mit seiner Entwicklung der Z3 im Jahre 1941 baute Zuse den ersten funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten und frei programmierbaren, in binärer Gleitkommarechnung arbeitenden Rechner und somit den ersten funktionsfähigen Computer der Welt.
Zuse als Künstler
Schon während seiner Jugendzeit hatte Zuse ein Talent, seine Visionen auch in künstlerischer Form auf Papier zu bringen. „Ich habe zwar kein Kunststudium, aber ein Informatikstudium habe ich auch nicht,“ sagte er über sich selbst. Seine Ölgemälde, Kreidezeichnungen und Linolschnitte signierte er zeitweise mit dem Pseudonym Kuno See. In seinem gesamten Leben malte er über 500 Bilder. Ein Großteil des künstlerischen Nachlasses befindet sich in der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Einige Werke sind im Hünfelder Konrad-Zuse-Museum und im Astronomisch-Physikalischen Kabinett in Kassel ausgestellt. Anlässlich des einhundertsten Geburtstages Zuses zeigte das Weiterbildungsinstitut (WbI) in Oberhausen eine Ausstellung von mehr als 130 Werken von Zuse. 2012 wurden im Rahmen der documenta 13 in Kassel Bilder von Konrad Zuse ausgestellt. Eines seiner letzten Bilder malte er von Bill Gates und übergab ihm das Porträt auf der Cebit 1995. Gates hängte es in seinem Büro auf.
Idee zur Prozesssteuerung
Für die Henschel-Flugzeug-Werke entwickelte Konrad Zuse die fest programmierten Spezialrechner S1 (1942) und S2 (1943) zur Flügelvermessung der Henschel-Gleitbombe Hs 293. Dabei kam ihm die Idee, das Ablesen der Messuhren zu mechanisieren. Die dafür gebauten Messgeräte waren die ersten Analog-Digital-Wandler. 1944 verwirklichte Zuse in einem ausgelagerten Werk der Henschel-Flugzeug-Werke in Warnsdorf im Sudetenland die erste Prozesssteuerung per Computer.
Lambda-Kalkül
Der Lambda-Kalkül ist eine formale Sprache zur Untersuchung von Funktionen. Er beschreibt die Definition von Funktionen und gebundenen Parametern und wurde in den 1930er Jahren von Alonzo Church und Stephen Cole Kleene eingeführt. Heute ist er ein wichtiges Konstrukt für die Theoretische Informatik, Logik höherer Stufe und Linguistik.
Plankalkül
Der Plankalkül ist eine von Konrad Zuse in den Jahren 1942 bis 1945 entwickelte Programmiersprache und war die erste höhere Programmiersprache der Welt. 1937 entdeckte Zuse während der Arbeiten an seinem ersten Computer den Aussagenkalkül neu. Während der Arbeit an der Z4 erkannte er, dass die Programmierung in Maschinensprache zu aufwändig war und deswegen eine höhere Programmiersprache nötig wäre. Zunächst dachte er, dass Esperanto dies leisten könnte. In den Jahren 1942/46, als Zuse durch die Kriegsereignisse nicht praktisch arbeiten konnte, entwarf er den „Plankalkül“, konnte ihn aber nicht veröffentlichen. An der Ludwig-Maximilians-Universität München konnte Zuse im Wintersemester 1948/49 in den Logik-Kolloquien von Wilhelm Britzelmayr über seine angewandte Logik vortragen. Die Idee zu höheren Programmiersprachen wurde erst zehn Jahre später wieder aufgegriffen, als Sprachen wie Fortran, Algol und Cobol entworfen wurden. Der „Plankalkül“ wäre universeller als diese Sprachen gewesen, ist aber erst im Jahr 1975 im Rahmen einer Dissertation von Joachim Hohmann implementiert worden. Zuse hatte schon vor dem Krieg mehrere Patente angemeldet. Am wichtigsten war jedoch eine Patentanmeldung von 1941, in der er die Z3 beschrieb. Die deutschen Prüfer hatten gegen Zuses Ansprüche keine Einwände, und das Patent wurde 1952 bekanntgemacht. Dagegen erhoben Triumph, später auch IBM Einspruch. Der Prozess zog sich durch sämtliche Instanzen, bis das Bundespatentgericht 1967 zur endgültigen Entscheidung kam, dass dem Erfinder des Computers „mangels Erfindungshöhe“ kein Patent erteilt werden könne. Auf die Idee, die Prozesssteuerung zu patentieren, kam Zuse nicht. Zuse tätigte insgesamt 58 Patentanmeldungen, aber nur acht Patente wurden erteilt.
Zuse AI
Der Erfinder des modernen Computers hat noch mehr vollbracht: Dazu zählen eine Programmiersprache – und Pionierleistungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.
Kurt Friedrich Gödel
Kurt Friedrich Gödel (* 28. April 1906 in Brünn, Österreich-Ungarn, heute Tschechien; † 14. Januar 1978 in Princeton, New Jersey, Vereinigte Staaten) war ein österreichischer und später US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und einer der bedeutendsten Logiker des 20. Jahrhunderts. Er leistete maßgebliche Beiträge zur Prädikatenlogik (Vollständigkeit und Entscheidungsproblem in der Arithmetik und der axiomatischen Mengenlehre), zu den Beziehungen der intuitionistischen Logik sowohl zur klassischen Logik als auch zur Modallogik sowie zur Relativitätstheorie in der Physik. Auch seine philosophischen Erörterungen zu den Grundlagen der Mathematik fanden weite Beachtung.
Im Jahr 2021 feiern wir nicht nur den 80. Jahrestag von Zuses Rechner, sondern auch den 90. Jahrestag von Kurt Gödel’s bahnbrechender Arbeit von 1931, die die Grundlagen der theoretischen Informatik und der KI-Theorie legte. Gödel identifizierte die fundamentalen Grenzen des Theorembeweisens, des Rechnens, der KI, der Logik und der Mathematik selbst. Dies hatte enormen Einfluss auf Wissenschaft und Philosophie des 20. Jahrhunderts. Es scheint kaum glaubhaft, dass binnen nicht mal eines Jahrhunderts etwas, das einst nur in den Köpfen solcher Titanen lebte, zu einem unverzichtbaren Teil der modernen Gesellschaft geworden ist. Die Welt schuldet diesen Wissenschaftlern viel. Noch 10 Jahre bis zur Gödel-Hundertjahrfeier 2031, 20 bis zur Zuse-Hundertjahrfeier 2041, und 1/4 Jahrhundert bis zur 4. Leibniz-Hundertjahrfeier 2046! Genug Zeit, um entsprechende Paraden zu planen.
Zuse KG

Die Zuse KG war das in den 1940er Jahren gegründete Unternehmen des Computerpioniers Konrad Zuse, das Ende der 1960er Jahre im Siemens-Konzern aufging.
Rechnender Raum
„Rechnender Raum“ ist Konrad Zuses 1969 erschienenes Buch über Automatentheorie. Er stellte die These auf, dass alle Prozesse im Universum rechnerisch erfolgen. Diese Ansicht ist heute als Simulationshypothese, digitale Philosophie, digitale Physik oder Pancomputationalismus bekannt. Zuse schlug vor, dass das Universum von einer Art zellulärem Automaten oder anderen diskreten Rechenmaschinen berechnet wird, und stellte damit die lange vertretene Ansicht in Frage, dass manche physikalischen Gesetze von Natur aus kontinuierlich seien. Er konzentrierte sich auf zelluläre Automaten als mögliches Substrat der Berechnung und wies darauf hin, dass die klassischen Begriffe der Entropie und ihres Wachstums in deterministisch berechneten Universen keinen Sinn ergeben. Zuse postulierte, dass alle Prozesse im Universum rechnerisch ablaufen. Diese Sichtweise ist heute als Simulationshypothese, digitale Philosophie, digitale Physik oder Pan-Computationalismus bekannt. Zuse postulierte, dass das Universum von einer Art zellulärem Automaten oder anderen diskreten Rechenmaschinen berechnet wird. Damit stellte er die lange vertretene Ansicht in Frage, dass manche physikalischen Gesetze von Natur aus kontinuierlich seien. Er konzentrierte sich auf zelluläre Automaten als mögliche Grundlage der Berechnung und wies darauf hin, dass die klassischen Konzepte von Entropie und deren Wachstum in deterministisch berechneten Universen keinen Sinn ergeben.
V1 alias ‘Z1’
‘Versuchsmodell 1’
1936

Bau der Z1 in der Wohnung von Zuses Eltern.
Die Z1 war ein mechanischer Rechner von Konrad Zuse aus dem Jahre 1937. Sie arbeitete als erstes frei programmierbares Rechenwerk mit binären Zahlen und verfügte über viele Rechner-Architekturelemente des späteren Modells Z2, war jedoch wegen mechanischer Probleme unzuverlässig. Ihre Nachfolger, die Zuse Z3, 1941 und Zuse Z4, 1945, waren die ersten universell programmierbaren Computer. 1936 stellte Zuse den logischen Plan für seinen ersten Computer, den V1 (V für Versuchsmodell), fertig. Tatsächlich trugen alle ersten Computer von Zuse die Bezeichnung V (V1 bis V4), aber nach dem Zweiten Weltkrieg änderte er ihre Namen in Z1 bis Z4, um die unangenehme Assoziation mit den Militärraketen V1-V4 zu vermeiden. Die Produktion begann im selben Jahr und der Prototyp war 1938 fertig (siehe Foto daneben). Damit war der Z1 der erste Relaiscomputer der Welt.
V2 alias ‘Z2’
1939
Die Zuse Z2 war ein Prototyp eines Rechners von Konrad Zuse zum Test der Relaistechnik. Die mechanischen Schaltglieder der Z1, Zuses erster Rechenmaschine, verhakten sich im Betrieb oft. Mit der Z2 wollte er prüfen, ob Relais zuverlässigere Bauelemente seien. Der Bau der Z2 war privat finanziert. Zuse kaufte von Telefonfirmen ca. 200 gebrauchte Relais, mit denen er sowohl das Rechenwerk, als auch die Programmsteuerungseinheit der Z2 baute. Die Z2 wurde 1939 fertiggestellt. Sie besaß eine Taktfrequenz von ca. 10 Hertz, ein binäres Festkommarechenwerk, welches die vier Grundrechenarten beherrschte, einen 16-Bit-Speicher und wog 300 Kilogramm. Die Pläne und jegliche Fotos der Z2 wurden durch Bombenangriffe auf Berlin 1943/1944 im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt hatte sich die Z2 angeschaut und gab Zuse 25.000 RM (entspricht heute etwa 120.000 EUR), damit er die Z3 bauen konnte. Wegen der Zuverlässigkeit elektrischer Relais setzte Zuse beim Bau seiner nächsten Rechenmaschine, der Zuse Z3, ausschließlich Relais ein.
V3 alias ‘Z3’
1941
Die Z3 war einer der ersten funktionsfähigen Digitalrechner weltweit und wurde am 12. Mai 1941 von Konrad Zuse in seiner Werkstatt in der Methfesselstraße 7 in Berlin-Kreuzberg vorgestellt. Zuse hatte ihn ab 1938 in Zusammenarbeit mit Helmut Schreyer in Berlin konstruiert. Die Z3 wurde in elektromagnetischer Relaistechnik mit 600 Relais für das Rechenwerk und 1400 Relais für das Speicherwerk ausgeführt. Die Z3 verwendete (wie auch bereits die Z1) die von Konrad Zuse in die Rechnertechnik eingeführte binäre Gleitkommaarithmetik. Im Gegensatz zum Entwurf und der Benutzung des ENIAC genügte der Entwurf der Z3 nicht der späteren Definition eines turingmächtigen Computers und sie wurde auch nie so genutzt. Erst nach dem Tod des Erfinders Konrad Zuse am 18. Dezember 1995 fand man 1998 heraus, dass sie rein theoretisch gesehen durch trickreiche Nutzung aufwendiger Umwege dennoch diese Eigenschaft hatte. Die Z3 gilt als erster funktionsfähiger Universalrechner der Welt. Sie ist auch der erste Rechner, der umgekehrte polnische Notation (UPN) nutzte (allerdings noch nicht so benannt). Die Maschine wurde am 21. Dezember 1943 bei einem Bombenangriff zerstört.
V4 alias ‘Z4’
1942 bis 1945
Die Zuse Z4 ist ein zwischen 1942 und 1945 von dem Zuse Ingenieurbüro und Apparatebau entwickelter Digitalrechner, der aus 2200 Relais gebaut ist. Er verfügt über einen elektromechanischen Speicher, der 64 Zahlen je 22 Bit aufnehmen kann.
S1
1942 bis 1943
Der S1 war ein Spezialrechner für die Henschel-Flugzeugfabrik in Berlin. Die Programmierung erfolgte über schrittweise Relais. Der S1 war nicht frei programmierbar. Der S1 besaß ein Festkomma-Rechenwerk und eine Wortbreite von 12 Bit. Anwendung war die Berechnung des Flügelflatterns. Zu diesem Teil von Zuses Werk gibt es teilweise unterschiedliche Angaben und Hinweise auf spezielle Maschinen zur Berechnung von Flügelmaßen. Laut Zuse Archiv war das S1-Modell ein spezieller Computer zur Flügelmessung. Der S1 wurde im Dezember 1943 bei einem alliierten Luftangriff zerstört. Die Rechner S1 und S2 Nach der Entwicklung des Z3 erhielt Zuse von seinem ersten Arbeitgeber, der Flugzeugfabrik Henschel, den Auftrag zur Entwicklung eines Spezialrechners zur Messung der Tragflächenoberfläche von Flugzeugen. Die Maschine S1 war 1942 fertig und enthielt rund 600 Relais und vorprogrammierte Programme. Das Unternehmen bestellte eine weitere Maschine, die 1944 fertig war. Der S2 war der Nachfolger des S1 und bestand aus rund 800 Relais und etwa 100 Messuhren zur Messung der Tragflächenoberfläche. Der S2 gilt als der erste Prozessrechner der Welt.
Z5
1950
Die Z5 war eine programmgesteuerte Rechenanlage, welche in elektromagnetischer Relaistechnik ausgeführt wurde. Weil die Maschine rund zwei Tonnen wog, könnte sie rückwirkend auch als erster Großrechner Deutschlands bezeichnet werden.
Z11
1957
Der Zuse Z11 war der erste serienmäßig produzierte Computer der Zuse KG, er war die Serienausführung des SM 1. Sie wurde 1955 entwickelt und wog 800 kg. Die Z11 basierte auf Relais- und Schrittschaltungen. Ab 1957 konnte er über Lochstreifen programmiert werden. Sein Energieverbrauch betrug 2 kW, und er arbeitete mechanisch mit einer Frequenz von 10 bis 20 Hz.
Z22
1955
Die Zuse Z22 oder kurz Z22 war eine ab 1955 von dem Physiker Lorenz Hanewinkel konstruierte und für die Zuse KG gebaute Elektronische Rechenanlage und der erste Röhrenrechner aus Westdeutschland. In der DDR wurde der vergleichbare D1 von 1950 bis 1956 entwickelt. Als einer der ersten in Serie produzierten Rechner weltweit ermöglichte die Z22 deutschen Hochschulen, Universitäten und anderen wissenschaftlichen Instituten nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals eine elektronische Datenverarbeitung.
Wiesenbauschule Suderburg
Die Wiesenbauschule Suderburg, gegründet 1853, war eine der ältesten landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen in Norddeutschland. Durch die Entwicklung des „Suderburger Rückenbaus“, eines damals neuartigen Bewässerungssystems, wurde sie auch überregional bekannt. Die Schule wurde später zur staatlichen Ingenieurschule aufgewertet und ging 1971 in der Fachhochschule Nordostniedersachsen auf. Seit 2009 gehört der Standort Suderburg, der bis heute einen Schwerpunkt im Wasserbau hat, zur Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Der Standort Suderburg besitzt als Besonderheit einen voll funktionstüchtigen Zuse Z22R.
https://www.suderburg-damals.de/html/zuse.html
Ex-Mitarbeiter ehren Computerpionier Zuse

Ex-Mitarbeiter Lehmann mit dem Computer aus den 60er Jahren.
Konrad Zuse’s Computer aus den 60er Jahren funktioniert noch heute. In seinem früheren Wohnort Hünfeld gibt es ihm zu Ehren an diesem Tag ein großes Fest. Bad Salzschlirf. Eine riesige Maschine füllt die ganze Wand in der Garage des Rentners Hubert Lehmann. Der zwei Tonnen schwere Apparat lagert zwischen Werkzeugen, alten Radios und Fotoapparaten seit fünf Jahrzehnten im hessischen Bad Salzschlirf, doch er funktioniert noch: der Z22, ein Relikt aus den Anfängen des Computerzeitalters. Er stammt aus der Firma des Bauingenieurs und Erfinders Konrad Zuse, der 1941 den ersten funktionstüchtigen Computer der Welt gebaut und nach dem Krieg in Haunetal-Neukirchen die erste kommerzielle Computerproduktion aufgebaut hat. Obwohl Zuse seine Firma wegen finanzieller Probleme schon Ende der 60er Jahre an Siemens verlor, begeistert die Erinnerung an ihn noch heute seine ehemaligen Angestellten. Am Dienstag wäre Zuse 100 Jahre alt geworden. In seinem früheren Wohnort Hünfeld gibt es ihm zu Ehren an diesem Tag ein großes Fest. Nach der Konstruktion des Z3 verhinderte zunächst der Zweite Weltkrieg seine Weiterentwicklung. Nach seinem Ende gründete Zuse in Haunetal-Neukirchen die Zuse KG. 1949 baute er den Z4, den damals einzigen funktionstüchtigen Computer Europas. Als Hubert Lehmann als 19-Jähriger als Feinmechaniker zu der Firma kam, war es 1957, und Zuse war bereits beim Modell Z22 angekommen, das Lehmann später von einem Kunden kaufte und in seiner Garage lagerte. Was genau Zuse da herstellte, verstand auf dem Land niemand so richtig. Nur dass es etwas Besonderes war, sei irgendwie klar gewesen, erzählt Lehmann. Lehmann drückt auf einen Knopf und mit einem lauten Brummen erwacht der Z22 zum Leben. “Ich hätte nicht gedacht, dass jemand irgendwann mal danach fragen würde”, sagt der 72-Jährige. Der Z22 ist ein Computer mit Röhrentechnik, eines von 56 Exemplaren, die zwischen 1957 und 1961 von der Zuse KG hergestellt wurden. Um mit der Z22 rechnen zu können, muss Lehmann einen Lochstreifen in ein Lesegerät einlegen. Auf den Streifen ist ein Programm geschrieben. Das Verfahren sei im Grunde heutzutage nicht viel anders, sagt der Rentner: “Man muss den Computern immer noch sagen, was sie tun sollen.” Viele der ehemaligen Zuse-Mitarbeiter verehren ihren Chef noch immer, sie nennen sich “Zuseaner” und treffen sich jedes Jahr. Zu Ehren seines 100. Geburtstages haben sie eine Gedenktafel an dem ersten Sitz der Zuse KG angebracht. Die alten Kollegen kennen sich untereinander, pflegen den Kontakt. Zu ihnen gehört auch Dieter Ostermeier, der noch in Neukirchen wohnt. Von seinem Haus hat er es nicht weit zu der ehemaligen Postrelaisstation, in der die ersten Rechenmaschinen gebaut wurden. Zwischen dem Kopfsteinpflaster im Innenhof wuchert Unkraut, in der ehemaligen Zuse-Werkstatt werden heute Autos repariert. “Dort oben im Gibelzimmer saß Konrad Zuse”, erzählt Ostermeier und deutet mit dem Finger auf das Dach des Fachwerkhauses. “Ihm schwirrte immer der Kopf. Manchmal ging er ganz in Gedanken versunken hier die Straße entlang. Ein echter Erfinder.” Doch nicht nur wegen seines Erfindergeistes schätzen ihn die ehemaligen Mitarbeiter noch heute, sondern auch wegen seines fairen Umgangs mit den Angestellten. “Das Geld war immer knapp, aber es ist nie vorgekommen, dass wir Mitarbeiter nicht bezahlt worden sind”, sagt Ostermeier. “Im Gegenteil, es gab sogar Kleinkredite für in Not geratene Mitarbeiter.” Ostermeier erinnert sich besonders gerne an die sozialen Leistungen, die die Firma ihren Mitarbeitern bot. “Sowas gibt es heute gar nicht mehr”, sagt er etwas wehmütig. Die Zuse KG sei ein echtes Familienunternehmen gewesen, schwärmt auch Lehmann. Zu ihren Kunden zählten überwiegend Universitäten und wissenschaftliche Institute. “Wenn es kurz vor Feierabend hieß, es sei noch ein Fehler zu beheben, dann ist man halt abends noch zum Kunden gefahren.” Doch die Firma konnte dem finanziellen Druck nicht standhalten. Zuse, der bereits 1957 mit dem Unternehmen nach Bad Hersfeld umgezogen war, musste die Firma 1964 wegen mangelnden Kapitals verkaufen. “Für ihn war der Verlust der Firma 1964 ein Schock”, erinnert sich sein Sohn Horst Zuse heute. Ab 1967 begann Siemens, die Zuse KG zu übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Atmosphäre im Unternehmen nicht mehr so persönlich gewesen, erzählt Lehmann. “Das Leben ist halt so”, sagt Zuses Sohn Horst ein bisschen traurig. “Er hat es nicht geschafft. Es gab viele Hindernisse und Konkurrenz.” Für die Computerentwicklung habe seine Vater dennoch “Meilensteine” gesetzt.
Z22R Programmieranleitung
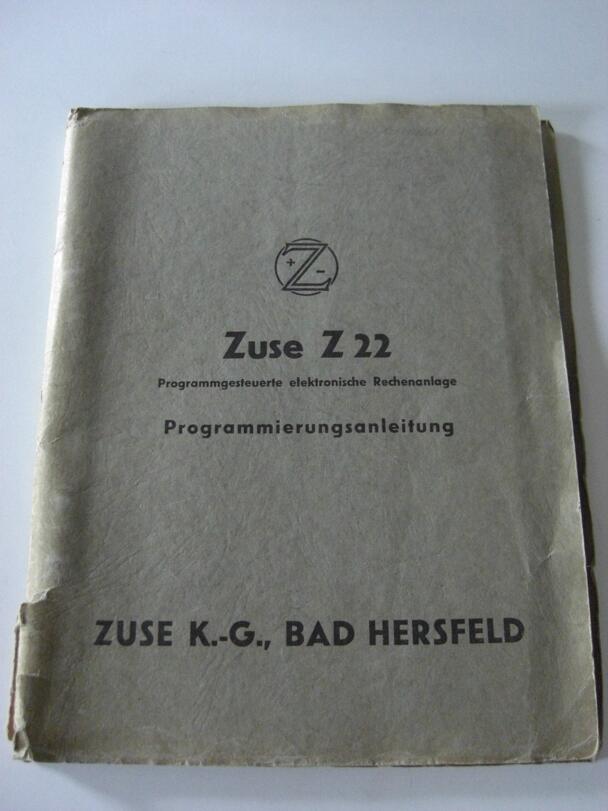
Auch die Original-Programmieranleitung der Konrad Zuse KG ist noch vorhanden.
Herr Hubert Lehmann die große Hilfe!

Seit den 1980er-Jahren hatte Hubert Lehmann die Z22R in Suderburg am Laufen gehalten. Leider verstarb der frühere Mitarbeiter der Konrad Zuse KG vor kurzem.
Und die Z22R läuft wieder

Januar 2001: Hubert Lehmann führt einen Testlauf der Z22R durch.
Doch derzeit ist die Röhrenmaschine defekt. Und schlimmer noch: Hubert Lehmann, ein früherer Mitarbeiter der Konrad Zuse KG, der bislang dafür gesorgt hatte, die aus dem Jahr 1960 stammende Zuse-Anlage in Suderburg am Leben zu erhalten, ist im vergangenen Monat verstorben. “Herr Lehmann war eine große Hilfe für uns und wir haben ihm viel zu verdanken”, erklärt Diplom-Ingenieur Detlef Krischak. Alle paar Jahre reiste der Rentner aus Osthessen an, blieb ein paar Tage in der Samtgemeinde, wartete die Anlage und beseitigte die eine oder andere Fehlfunktion. Der Kontakt entstand schon Anfang der 1980er-Jahre – doch seither wird der Kreis der Personen, die sich auf Röhrentechnik bei Computern verstehen, immer kleiner. “Hinzu kommt, dass die Anlage sehr empfindlich ist”, verdeutlicht Krischak, “um die Z22R betreiben zu können, brauchen wir beispielsweise acht verschiedene Spannungen.” Aktuell gibt es große Probleme mit dem optischen Lochstreifenleser, über den die Maschine mit Programmen und Daten gefüttert wird. Der Campus Suderburg sucht deshalb Personen, die eine Instandsetzung durchführen können. “Einen Basisbetrag für die Reparatur haben wir bereits zusammen”, schildert Systemadministrator Krischak im Gespräch mit heise online, “aber natürlich würden wir uns auch über Spenden oder sonstige Hilfen freuen.” Die Z22R in Suderburg wurde übrigens 1972 dem Landeskulturamt Hannover abgekauft, das damit in den 1960er-Jahren unter anderem Flächenberechnungen durchführte.
Wer den Campus Suderburg beim Weiterbetrieb einer der wenigen noch funktionstüchtigen Zuse-Rechner unterstützen möchte, kann sich direkt an Diplom-Ingenieur Detlef Krischak (d.krischak@ostfalia.de) wenden.
Z23
1961
Die Zuse Z23 war ein erstmals 1961 ausgelieferter Transistorcomputer, konstruiert von der Zuse KG in Bad Hersfeld. Bis 1967 wurden insgesamt 98 Einheiten an gewerbliche Kunden (Reaktorphysik, Ballistik, Vermessungstechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, Bergbau) sowie an Behörden und an Hoch- und Fachhochschulen verkauft.
Z25
1963
Die Z25, auch Zuse Z25, war ein programmgesteuerter elektronischer Rechner der Zuse KG in Bad Hersfeld auf der Basis von Transistoren, der ab 1963 in Serie gebaut wurde. Die bei ihrer Auslieferung aufgetretenen Probleme trugen zum Niedergang und schließlich der Übernahme der Zuse KG bei. Mit der Z25 war es auch möglich, „on-line“ direkt Daten an den Graphomat zu übertragen. Der Graphomat arbeitete mit Transistoren.
Z31
1968
Heutzutage verfügt jedes größere Unternehmen, das seine führende Marktposition behaupten möchte, standardmäßig über elektronische Datenverarbeitungsanlagen. Um den Einsatz solcher Anlagen auch in kleinen und mittleren Unternehmen zu ermöglichen, hat die ZUSE KG den ZUSE Z 31 entwickelt. Diese preisgünstige Maschine ist programmgesteuert und zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Sie ist in Transistortechnik aufgebaut. Sie besteht aus einer sorgfältig ausgewählten Baugruppe, die die kostengünstige Realisierung zahlreicher Spezialanwendungen ermöglicht.
Der ZUSE Z 31 passt sich der Art und Bedeutung jeder Tätigkeit an, und seine Erweiterungsmöglichkeiten lassen keine Angst vor Unter- oder Überdimensionierung aufkommen. Die einfache Wartung und Instandhaltung verleihen diesem Computer einen ganz besonderen Wert. Durch die interne Verwendung des Dezimalsystems, das sehr hohe Ein- und Ausgabegeschwindigkeiten ermöglicht, kann diese Allzweckmaschine ein breites Spektrum an Problemen bewältigen. Ein großer Vorteil für den Benutzer des ZUSE Z 31 besteht darin, dass er vorhandene Lochstreifengeräte unabhängig vom verwendeten Code weiterverwenden kann.
Die moderaten Kosten dieses Computers ermöglichen großen Organisationen eine Dezentralisierung der Tätigkeitsbereiche, was die Organisation und den Transfer von Daten erheblich vereinfacht.
Anlagen zur kommerziellen Datenverarbeitung zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Programme im Allgemeinen relativ wenige Anweisungen enthalten. Selbst wenn diese Anweisungen ein großes Datenvolumen erfordern, werden diese nach der gleichen Methode blockweise verarbeitet, sodass die Maschine nur relativ kleine Programme speichern muss. Meistens ist jedoch ein Speicher mit sehr großer Kapazität erforderlich (z. B. zur Speicherung der verschiedenen Artikel eines großen Geschäfts, der Konten einer Bank usw.).
Von den Ein- und Ausgabegeräten, die bei Computern für gewerbliche Zwecke von zentraler Bedeutung sind, wird höchste Flexibilität verlangt. Das bei der Konstruktion verwendete System von Layouteinheiten bietet die ideale Lösung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Als Dezimalrechner ist die Anlage besonders für die Verarbeitung großer Mengen von Ein- und Ausgabedaten ausgelegt und eignet sich somit zur Lösung gewerblicher Probleme. Die Speicherkapazität lässt sich durch Anschluss zusätzlicher Speicher beliebig erweitern und die Ein- und Ausgabegeschwindigkeit durch Hinzufügen entsprechender Geräte auf bis zu 1.000 Zeichen/s steigern. Ein einfacher Befehlscode erleichtert die Bedienung. Ein Vergleichsgerät bietet große Vorteile für Rechercheprozesse oder Übersetzungsprogramme.
Ausgestattet mit zwei Akkumulatoren kann er beispielsweise arithmetische und logische Operationen gleichzeitig im Rechenwerk verarbeiten. Mit einem Befehl kann der Inhalt der Akkumulatoren in jede Zelle des Schnellspeichers addiert werden. Jeder Befehl kann abhängig vom Inhalt der speziellen Bedingungsspeicher oder denen der Akkumulatoren bedingt sein. Beim Programmieren können Befehle und Speicher durch Adresssubstitution und Adressmodifikation eingespart werden. Rückkonvertierungsprogramme ermöglichen bei Bedarf die Verwendung eines praktischen externen Codes.
Graphomat Z64
1961
Der Graphomat Z64 war eine maßgeblich von Konrad Zuse entwickelte automatische Zeichenmaschine der Zuse KG. Produziert wurde sie 1961–1964. Mit ihr war es möglich, zuvor von einem Rechner berechnete Zeichnungen großformatig und genau umzusetzen. Sie galt zu ihrer Zeit als die genaueste Maschine dieser Art. Es wurden 98 Geräte verkauft.
Der Graphomat Z64 ist ein lochstreifen- oder lochkartengesteuerter Plotter. Diese Maschine wurde 1961 auf der Hannover Messe vorgestellt. Es handelt sich um einen Plotter mit zwei Zahnrädern. Die digitalen Anweisungen auf einem Lochstreifen, die von einem Zuse Z22, Z23, Z25 oder Z31-Rechner erzeugt wurden, wurden von den beiden Zahnrädern in eine x- und y-Bewegung umgesetzt. Die Genauigkeit war sehr hoch: 1/16 mm und 16 verschiedene Geschwindigkeiten in beide Richtungen waren möglich. Es war der letzte große Beitrag von Konrad Zuse für Rechenmaschinen. Alle mechanischen Teile wurden von ihm entworfen. Vollautomatisches Plotten diskreter Punkte, beliebiger Kurven und erklärender Symbole, beispielsweise für die Geodäsie, Meteorologie und den Straßenbau. Auf der DVD von Konrad Zuse ist ein Video über die Funktionsweise des Z64 zu sehen.
Zweiter Weltkrieg
Konrad Zuse erfand in der Oranienstraße den ersten Rechner
‘Ein Computer für Hitler’
Es ist das Jahr 1992: Ein alter Mann steht an der Kellertreppe der Oranienstraße 6. Es ist der 85-Jährige Konrad Zuse, drei Jahre vor seinem Tod. In den letzten Weltkriegsjahren 1944/45 tüftelte er hier für die Nazis an einem der ersten Computer der Welt. ZOOM BERLIN sprach mit seinem Sohn und zeigt bislang noch unveröffentlichte Fotos und Dokumente. Es waren die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs. Während die alliierten Piloten Nazi-Deutschland mit ihren Fliegerbomben in die Knie zwingen wollten, tüftelte Erfinder Konrad Zuse versteckt im Keller der Oranienstraße 6 in den Jahren 1944/1945 an seinem Z4-Rechner, einem der ersten Computer der Welt. Konrad Zuses Sohn Horst Zuse (66) ist heute selbst Informatik-Professor. Er erzählt: “Aufgrund der Luftangriffe musste mein Vater alle wichtigen Gerätschaften in die Kellergewölbe der Oraninenstraße 6 schaffen. Seine große Produktionsstätte in der Kreuzberger Methfesselstraße, wo die anderen Maschinen standen, war schon 1943 bei einem Bombenangriff zerstört worden.”
Mit einem “Kriegsauftrag” über 25.000 Mark vom Reichsluftfahrtsministerium ausgestattet, sollte Zuses Computer dem “Dritten Reich” auf dem Gebiet der Informationstechnologie Vorsprung gegenüber den Alliierten bringen. So hieß es in einem geheimen Schriftstück vom 1. November 1944: “Namens und im Auftrag des Reichs werden Sie hiermit mit Untersuchungen, Bau und Erprobung von Versuchssätzen für die mechanische Schaltgliedtechnik beauftragt.” Auch in der neuen Tüftler-Werkstatt konnte Zuse nicht ungestört arbeiten. So klagte er im August 1944 in einem Brief, der ZOOM BERLIN exklusiv vorliegt, an einen befreundeten Apparatebauer: “Ich bekam sofort sehr schöne Fabrikräume in der Oranienstraße, welche einige Zeit später durch eine Luftmine stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.”
Den Brief schließt er dann als offenbar überzeugter Nationalsozialist “Mit deutschem Gruß!” Konrad Zuses Sohn hat diese Dokumente aufbewahrt, darunter auch das Foto seines Vaters im Hof der Oranienstraße 6, das im Jahr 1992 entstand. Horst Zuse sagt, wie die Computerproduktion in der Oranienstraße 6 ihr Ende nahm: “Am 16. März 1945, kurz vor Kriegsende, wurde die Maschine in 20 Kisten verpackt und zum Anhalter Bahnhof gehievt, in einen Zug nach Göttingen verladen, um sie vor der Zerstörung zu schützen.” Schon 1937 hatte Konrad Zuse in seinem Tagebuch festgehalten, was ihn seit langer Zeit umtrieb: “Seit einem Jahr beschäftige ich mit dem Gedanken des mechanischen Gehirns.”
Dann folgt in dem Tagebuch die “Erkenntnis dass es Elementaroperationen gibt, in die sich sämtliche Rechen- und Denkoperationen auflösen lassen.” Im Rückblick ein prophetischer Satz. Aber Zuses Z4-Maschine hatte fast nichts mit einem heutigen Computer gemeinsam. Sie brauchte 15 Quadratmeter Platz, die binären Rechenschritte wurden von 2200 Relais ausgeführt oder von Stahlkonstruktionen, wie an Vorgänger-Modell Z3 noch heute zu sehen ist. Konrad Zuse sollte die Z4 erst 1950 fertigstellen. Zuses Pionierarbeit hat glücklicherweise dem Unrechtsregime nicht mehr zum Endsieg verhelfen können.
Aber wer heute online die Oranienstraße erkundet, kann sich erinnern, wie primitiv und gleichzeitig genial das digitale Zeitalter seinen Anfang nahm. Und Konrad Zuse? Er starb 1995 mit 85 Jahren in Hünfeld, seiner hessischen Nachkriegswahlheimat. Heute gilt der Erfinder aus der Oranienstraße als einer der Ur-Väter des Computers.
Der Bauingenieur Konrad Zuse entwarf im Zweiten Weltkrieg die ersten programmgesteuerten Rechenmaschinen in Deutschland und wurde damit zu einem der „Erfinder des Computers“. Das Forschungsprojekt hinterfragt seine Rolle als Erfinder und Unternehmer im NS-Staat und in der Nachkriegszeit.
Die im Krieg zerstörte Z3 von Konrad Zuse, die 1941 erstmals voll funktionsfähig war, gilt als erstes frei programmierbares vollautomatisches Rechengerät überhaupt. Sie wird in der Ausstellung Informatik des Deutschen Museums in einem von Zuse autorisierten funktionsfähigen Nachbau gezeigt und vorgeführt.
Von 1935 über die Zuse Z1 bis zur Turing-Bombe
1935 stellten IBM die IBM 601 vor, eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro Sekunde durchführen konnte. Es wurden ca. 1500 Exemplare verkauft. 1937 meldete Konrad Zuse zwei Patente an, die bereits alle Elemente der so genannten Von-Neumann-Architektur beschreiben. Im selben Jahr baute John Atanasoff zusammen mit dem Doktoranden Clifford Berry einen der ersten Digitalrechner, den Atanasoff-Berry-Computer, und Alan Turing publizierte einen Artikel, der die Turingmaschine, ein abstraktes Modell zur Definition des Algorithmusbegriffs, beschreibt. 1938 stellte Konrad Zuse die Zuse Z1 fertig, einen frei programmierbaren mechanischen Rechner, der allerdings aufgrund von Problemen mit der Fertigungspräzision nie voll funktionstüchtig war. Die Z1 verfügte bereits über Gleitkommarechnung. Sie wurde im Krieg zerstört und später nach Originalplänen neu gefertigt, die Teile wurden auf modernen Fräs- und Drehbänken hergestellt. Dieser Nachbau der Z1, der im Deutschen Technikmuseum in Berlin steht, ist mechanisch voll funktionsfähig und hat eine Rechengeschwindigkeit von 1 Hz, vollzieht also eine Rechenoperation pro Sekunde. Ebenfalls 1938 publizierte Claude Shannon einen Artikel darüber, wie man symbolische Logik mit Relais implementieren kann. (Lit.: Shannon 1938). Während des Zweiten Weltkrieges gab Alan Turing die entscheidenden Hinweise zur Entzifferung der Enigma-Codes und baute dafür einen speziellen mechanischen Rechner, Turing-Bombe genannt.
IBM und der Holocaust
IBM hatte auf dem Gebiet der standardisierten Lochkarten und deren Auswertung weltweit eine monopolartige Stellung. In Deutschland war IBM bis 1949 durch die Tochtergesellschaft DEHOMAG vertreten. Auch während der NS-Zeit lieferte das Unternehmen Milliarden von Lochkarten an seine deutsche Tochtergesellschaft DEHOMAG, die unter anderem dazu genutzt wurden, im Auftrag des NS-Regimes die Erfassung der jüdischen Bürger und den Holocaust effizienter zu organisieren. Die DEHOMAG (Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH) war Hersteller und Vermieter von elektromechanischen Maschinen zum Be- und Verarbeiten von Lochkarten.
IBM und der Holocaust: Die Verstrickung des Weltkonzerns in die Verbrechen der Nazis (engl. Originaltitel: IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germany and America’s Most Powerful Corporation) ist ein Buch des Investigativjournalisten Edwin Black, das 2001 erstmals veröffentlicht wurde. Black stellt im Detail die Geschäftsbeziehungen des US-Konzerns IBM und seiner deutschen wie europäischen Tochterfirmen mit der deutschen Regierung Adolf Hitlers während der 1930er Jahre und der Zeit des Zweiten Weltkriegs dar. Eine Kernaussage des Buches ist Blacks These, dass die Technologie von IBM den Völkermord ermöglichte, vor allem durch die Herstellung und Tabellierung von Lochkarten auf der Basis von Daten aus der Volkszählung. Die Neuauflage von 2012 bot eine um 37 Seiten bisher unveröffentlichter Dokumente erweiterte Ausgabe. Dazu kamen Fotos und anderes Archivmaterial.
Entwicklung des modernen turingmächtigen Computers
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
Ebenfalls im Krieg (1941) baute Konrad Zuse die erste funktionstüchtige programmgesteuerte binäre Rechenmaschine, bestehend aus einer großen Zahl von Relais, die Zuse Z3. Wie 1998 bewiesen werden konnte, war die Z3 turingmächtig und damit außerdem die erste Maschine, die – im Rahmen des verfügbaren Speicherplatzes – beliebige Algorithmen automatisch ausführen konnte. Aufgrund dieser Eigenschaften wird sie oft als erster funktionsfähiger Computer der Geschichte betrachtet. Die nächsten Digitalrechner waren der in den USA gebaute Atanasoff-Berry-Computer (Inbetriebnahme 1941) und die britische Colossus (1941). Sie dienten speziellen Aufgaben und waren nicht turingmächtig. Auch Maschinen auf analoger Basis wurden entwickelt.
Auf das Jahr 1943 wird auch die angeblich von IBM-Chef Thomas J. Watson stammende Aussage „Ich glaube, es gibt einen weltweiten Bedarf an vielleicht fünf Computern.“ datiert. Im selben Jahr stellte Tommy Flowers mit seinem Team in Bletchley Park den ersten „Colossus“ fertig. 1944 erfolgte die Fertigstellung des ASCC (Automatic Sequence Controlled Computer, „Mark I“ durch Howard H. Aiken) und das Team um Reinold Weber stellte eine Entschlüsselungsmaschine für das Verschlüsselungsgerät M-209 der US-Streitkräfte fertig. Zuse hatte schließlich bis März 1945 seine am 21. Dezember 1943 bei einem Bombenangriff zerstörte Z3 durch die deutlich verbesserte Zuse Z4 ersetzt, den damals einzigen turingmächtigen Computer in Europa, der von 1950 bis 1955 als zentraler Rechner der ETH Zürich genutzt wurde.
Irene Dixon
Irene Dixon (1. Juni 1924 – 1. Januar 2021), Codeknackerin von Bletchley Park, wurde im Osten Londons geboren und war 1943 eine der ersten Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs zur streng geheimen Einheit geschickt wurden, um Signale von Hitlers Oberkommando zu entschlüsseln und ihre Arbeit jahrzehntelang geheim zu halten. Auch die heute über 90-jährige Irene Dixon war dort. Erst Jahrzehnte nach dem Krieg entdeckte Dixon, dass sie hochsensible Informationen verarbeitet hatte.
„Wir fanden heraus, dass wir verschlüsselte Nachrichten abfingen, die Hitler an seine Generäle geschickt hatte“, sagte sie gegenüber AFP.
„Hitler wäre außer sich vor Wut gewesen, wenn er es gewusst hätte, denn wir entschlüsselten die Nachrichten sogar vor seinen Generälen.“ Dixon und andere „Wrens“ aus der Frauenabteilung der Royal Navy waren zur Geheimhaltung verpflichtet und selbst andere Arbeiter in Bletchley Park wussten nichts von der Existenz des riesigen Computers, der einen ganzen Raum einnahm.
„Einige der Wrens fragten, warum es so heiß sei (in der Nähe des Colossus-Raums), und manche trockneten ihre Wäsche nebenan“, erinnerte sich Dixon.
Mithilfe der von Colossus entschlüsselten Informationen konnten die Alliierten bestätigen, dass Hitler fälschlicherweise angenommen hatte, das Ziel der Landung am D-Day würde Calais sein. Experten sind der Ansicht, dass der Supercomputer den Krieg möglicherweise um zwei Jahre verkürzt und dabei Millionen von Menschenleben gerettet hat.
Familie Zuse
1945 heiratete Zuse eine seiner Mitarbeiterinnen, Gisela Ruth Brandes. Sie hatten fünf Kinder: Horst, Klaus Peter, Monika, Hannelore Birgit und Friedrich Zuse.
Horst Konrad Zuse
Prof. Dr. Ing. Horst Konrad Zuse (* 17. November 1945 in Hindelang) ist ein deutscher Informatiker.
Werdegang und Tätigkeiten
Zuse ist Sohn des Erfinders des ersten binären Digitalrechners, Konrad Zuse. Er studierte von April 1967 bis Dezember 1973 an der Technischen Universität Berlin Elektrotechnik. Dies schloss er im Dezember 1973 mit Diplom ab. Im März 1983 promovierte er zum Dr.-Ing. auf dem Gebiet der Softwarekomplexitätsmaße und im Dezember 1998 schloss er erfolgreich seine Habilitation an der TU Berlin (Lehrbefugnis für praktische Informatik) ab. 2006 hat ihn die Hochschule Lausitz (FH) zum Honorarprofessor und 2009 zum Professor ernannt. Er ist spezialisiert im Bereich Softwaretechnik und entwickelte von 1996 bis 2000 die Konrad Zuse Multimedia Show, welche sich mit der Historie der Computerentwicklung beschäftigt. Ab Juni 1998 bis September 2008 war er Privatdozent an der TU Berlin. Von Februar 1998 bis Mai 1998 war er als Gastprofessor an der Southwestern Louisiana Universität in Lafayette (Vereinigte Staaten) tätig; von November 2003 bis November 2006 war er Gastprofessor an der Hochschule Lausitz (FH). Seit Dezember 2008 ist er hauptsächlich an der Hochschule Lausitz tätig und hat weiterhin eine geringfügige Lehrtätigkeit an der TU Berlin. 2010 stellte Zuse den von ihm in Kooperation mit dem Elektrotechnik-Konzern Finder durchgeführten, originalgetreuen Nachbau des von seinem Vater Konrad Zuse konstruierten Z3 fertig. Dieser ist seither im Heinz Nixdorf MuseumsForum ausgestellt. Gemeinsam mit Wilhelm Mons veröffentlichte Horst Zuse zwei Bücher über seinen Vater. Seit März 2015 ist Horst Zuse Mitglied im Senat der nach seinem Vater benannten Deutschen Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse. Horst Zuse ist mit einer Informatikerin verheiratet.
Konrad Zuse and his first computer of the world – TV report from 1958 (with subtitles)
( https://www.youtube.com/watch?v=n8Yo-wD-QTo )
Konrad Zuse Interview ZDF Mosaik 1985
( https://www.youtube.com/watch?v=SgLOV5H4d30 )
Computer History: Dr. Konrad Zuse, Computer Pioneer and the Z Computers (Z3) (Germany 1935-1945)
( https://www.youtube.com/watch?v=6GSZQ9g-jiY )
Die Z1, die Replik des ersten Computers der Welt, wird wieder lauffähig!
( https://www.youtube.com/watch?v=R5XnuT6ZLKg )
Die Zuse Z22 in Karlsruhe
( https://www.youtube.com/watch?v=IuAhmAPSYVk )
Horst Konrad Zuse zeigt seinen Nachbau der legendären Z3
( https://www.youtube.com/watch?v=_YR5HhWlOgg )
Horst Zuse‘s Z3 Part 1: Demonstration
( https://www.youtube.com/watch?v=mxIbNPpmFT8 )
Horst Zuse‘s Z3 Part 2: Interview
( https://www.youtube.com/watch?v=wnRMQ5bVQF4 )
Konrad Zuse Internet Archive
..,-